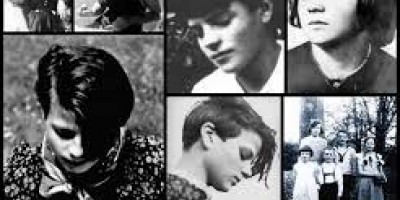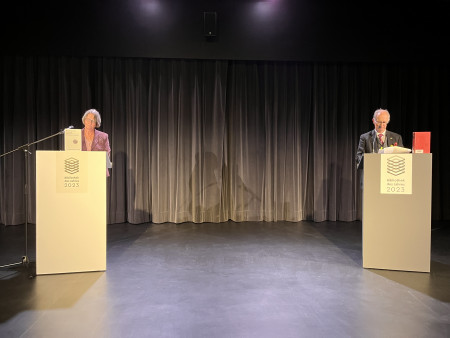
Düsseldorf erinnert: Zur Lesung "Das Echolot.Abgesang ´45
Am 8. Mai 1945 geht der zweite Weltkrieg zunächst in Europa nach 2077 Tagen mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands zu Ende (in Asien wird er noch bis Anfang September 45 dauern). Das Land, das den Krieg am 1.9.1939 begonnen hat und die Schuld an über 75 Millionen Toten, darunter 6 Millionen ermordeter Jüdinnen und Juden, trägt, ist endlich besiegt und die unmenschliche nationalsozialistischen Gewaltherrschaft endgültig zertrümmert.
In den Maitagen vor 80 Jahren atmeten Millionen von unterdrückten und verfolgten Menschen, die die Nazityrannei überlebt hatten, erschöpft auf. Für sie, die im Widerstand mutig ihr Leben wagten, die untertauchen konnten, in den Konzentrationslagern leiden und als sog. Zwangs- und Fremdarbeiter in der Kriegsindustrie und Landwirtschaft schuften mussten, war es ein Tag der Befreiung.
Die wohl meisten Deutschen waren froh, dass sie übrigblieben, wie man damals oft zum Abschied sagte. Doch für die nicht wenigen Täter und Regimetreuen war es ein Tag der Niederlage und Schande, auch wenn sie diese nicht auf ihr verbrecherisches Verhalten bezogen.
Nur wenige von ihnen wurden angeklagt und verurteilt, einige prominente Nazis zu
Recht auch zum Tode, doch viel zu viele kamen ungeschoren davon und konnten im Nachkriegsdeutschland wieder Karriere machen. Ehemalige Blutrichter sprachen weiter Urteile, Durchhalteoffiziere stolzierten dreist mir ihren Ritterkreuzen umher und so manch einer von „Hitlers Helfern“ beriet die Regierung und verkaufte Memoiren in Millionenhöhe. Ihnen allen gemeinsam war, dass sie von Befehlsnotstand sprachen, von nichts gewusst hatten und auf Verjährung drangen.
Ihre überlebenden Opfer aber krankten lebenslang an Körper und Seele, ihre Traumata waren so tief, dass auch ihre Kinder und Enkel daran litten, sie stießen auf eine abweisende Umwelt, die von den Verbrechen nichts wissen wollte. Für ein kleines bisschen Entschädigung mussten sie demütigende Bittgänge zu hartherzigen Beamten oftmals mit brauner Vergangenheit antreten.
Vor diesem Hintergrund war die Rede von Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 im Bundestag wegweisend, weil er erstmals klar aussprach, dass der 8. Mai 1945 „für uns alle“ in einer nachbetrachteten historisch Perspektive ein „Tag der Befreiung“ vom „menschenverachtenden System der NS-Gewaltherrschaft“ war und der 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 zu trennen sei.
40 Jahre nach Weizsäckers Rede könnte man angesichts der Tatsache, dass mit der Vogelschiss-AfD rechtsextremes Gedankengut Partei geworden ist, die Frage stellen, ob wir immer noch so unvoreingenommen von einem Tag der Befreiung reden können.
Noch dazu, wenn man bedenkt, wie dröhnend das schamhafte Beschweigen um die
deutschen Verbrechen war, welche Diskussionen um Schlussstriche geführt wurden und wie oft versucht wurde den Holocaust zu leugnen oder zu relativieren.
Laut einer gerade veröffentlichten Studie der Stiftung „Erinnerung Verantwortung Zukunft“ wünscht sich erstmals eine relative Mehrheit von 38 % der Befragten, dass ein „Schlussstrich“ unter die deutsche NS-Vergangenheit gezogen wird. Und knapp 45 % ärgern sich, „dass den Deutschen auch heute noch die Verbrechen an den Juden vorgehalten werden.“
Waren und sind das Debatten, die Befreite führen, die dankbar dafür sein sollten glimpflich davon gekommen zu sein und sich ihrer Verantwortung bewusst sind?
Für die von den Nazis Unterdrückten und Verfolgten ist der 8. Mai 1945 sicherlich ein lang erhoffter Tag der Befreiung gewesen. Für die Durchschnittsdeutschen könnte man dagegen in der Nachschau diesen einschneidenden Tag als eigentlich unverdiente Chance für einen Neubeginn betrachten für den wir den alliierten Soldaten auf ewig dankbar sein müssten, die unter furchtbaren Verlusten Nazi-Deutschland besiegt haben.
Der 8. Mai sollte daher als ein Gedenktag der Verpflichtung zur Erinnerung und zur Verantwortung begriffen werden. Gerade vor dem Hintergrund des Endes der Zeitzeugenschaft, des wieder entflammten Antisemitismus und den neuen extremistischen Gefahren sind wir es den Opfern und Überlebenden schuldig, dass wir uns erinnern und in Solidarität mit allen Verfolgten in der Welt alles für ein tatkräftiges, nicht phrasenhaftes „Nie wieder!“ tun.
Wir lasen am 6.5.25 in der Zentralbibliothek aus Briefen, Erinnerungen, Meldungen und Tagebucheintragungen, die der Schriftsteller und Chronist Walter Kempowski in seinem gigantischen und sorgsam arrangierten kollektiven Tagebuch „Das Echolot“ versammelt hat. In dem 2005 erschienen „Abgesang 45“ führte Kempowski nach 25 Jahren sein 1941 einsetzendes Weltkriegsepos zu Ende.
An vier ausgewählten entscheidenden Tagen, dem Geburtstag Hitlers am 20. April 1945, dem Treffen amerikanischer und sowjetischer Soldaten am 25. April in Torgau, dem Selbstmord Hitlers am 30.4. und der Kapitulation Deutschlands am 8/9. Mai 1945 holt Kempowski die Stimmen der Toten und der Stummen, der Opfer, Mitläufer und Täter mit dem Echolot aus der Tiefe.
Einigen von ihnen gaben Andrea Sonnen von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Düsseldorf, Peter Hommes von der Zentralbibliothek Düsseldorf, Dr. Benedikt Mauer vom Stadtarchiv Düsseldorf und Volker Neupert von den Düsseldorfer Beiträgen - Respekt und Mut während der Lesung ihre gegenwärtigen Stimmen.